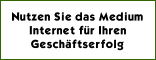Kantorei und Solisten zeigten hohes Niveau
(hr) (khm) In einem sehr gut besuchten Kirchenkonzert wurden am gestrigen Sonntag, 22. Dezember, in der Eberbacher Michaelskirche aus J. S. Bachs Weihnachtsoratorium, seiner (Sammlung von sechs Kantaten zur Weihnachtszeit (BWV 248, 1734/35), die Kantaten I bis III aufgeführt.
Die Ausführenden waren Bezirkskantor Andreas FauĂź als Leiter und Einstudierender, die Eberbacher Evangelische Kantorei, die Kurpfalzphilharmonie Heidelberg sowie die Gesangssolisten Doreen Ziegler (Sopran), Caroline Bauer (Alt), Sebastian Hübner (Tenor) und Lorenz Miehlich (Bass).
Entschieden hatte man sich bei der Auswahl aus Bachs populärster und melodiereichster Kirchenmusik, die man zwar als “sechsteiliges, auf innerer Einheit beruhendes Oratorium“ und nicht nur als sechsteilige “Anthologie-Blütenlese Bachscher Musik" zu betrachten hat, aber doch für die beliebte, die drei ersten Kantaten komprimierende Torso-Lösung. Recht plausibel erscheint diese Auswahl immer wieder, da sie die "Weihnachtsgeschichte vor dem Heiligen Abend im engeren Sinne" zusammenfasst, nämlich "Geburt Jesu, deren Verkünd(ig)ung an die Hirten und derselben Gang nach Bethlehem". Diese Kantaten waren geschaffen worden für die drei eigentlichen Weihnachtsfesttage. In Philipp Spittas Bach-Werk von 1880 (Bd. II 413) werden drei Kantatenabschnitte angenommen: “Weihnachtsgeschichte I-III, davon abgesetzt “Beschneidung und Namenstag Jesu“ (Kantate IV), und dann “Drei Könige / Weise vor dem Jesuskind und ihr Verhalten gegenüber Herodes" (Kantaten V-VI) - eine Einteilung, welche die Torso-Lösung auch empfiehlt. Angesichts der Gesamtanzahl von 64 Chören, Arien, Chorälen (Kirchenliedern) und Evangelisten-Rezitativen, die allein in den drei ersten Kantaten 36 Musiknummern ausmachen, wird man bei einer Besprechung nur auswählend vorgehen können, da zu viele Details ebenso wenig brächten "wie die Schilderung eines Waldes durch Aufzählen seiner Bäume" (Albert Schweitzer).
Zu Anfang der Besprechung stehe eines der vielen nicht uninteressanten Details vom kompositorischen Gespür und Geschick Bachs. Im Eingangschor zur ersten Kantate “Jesu Geburt" steht der Text "Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage". In Bachs eigener musikalischen Vorlage, die er hier melodisch wieder verwendete, dem "Dramma per musica” (1733, BWV 214,1 zu Ehren von Königin Maria Josepha (1699-1757), Tochter des römisch-deutschen Kaisers Joseph I. und Frau des sächsischen Kurfürsten / polnischen Königs Friedrich August III. (1696-1763, A. Schweitzer, a. O., S. 675) hatte zur Musik gut passend gestanden “Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! Klingende Saiten, erfüllet die Luft!". Wegen des besseren musikalischen Nachzeichnens der Textworte im ursprünglichen Werk werden diese Worte zwar gelegentlich auch im Oratorium gesungen (FAZ. 4.11.2011, S.30), aber eine klangprächtiger jubelnde Einleitungsmusik, zum Ausdruck von fröhlicher und zuversichtlicher Weihnachtsstimmung hätte Bach wohl auch nicht neu jederzeit erfinden können. Bei ihrer Darbietung hier enttäuschten die versierten Orchestermusiker die Erwartungen nicht, dass man volltönende Trompeten hören werde, dazu prunkende Pauken und rauschende Streicherskalen (Tonleitern), die geradezu bildhaft "wie aus dem Wolkenhimmel herabstürzende, Dunkelheit vertreibende Lichtstrahlen wirkten" (G. Jena). Der Chor seinerseits meisterte bei aller Orchesterwucht seinen Part auch bei den im Mittelabschnitt häufigen Koloraturen und Fugierungen. Eine Binnendifferenzierung durch ruhigeres Singen der kunstvoll imitierenden Koloraturen hätte die trompetenlose Mitte auch etwas von den effektvollen Eckpartien abheben können. All dies zeigte, was ein nicht-professioneller Chor unter Leitung seines engagierten Dirigenten und durch Probenarbeit leisten kann.
Die a-Moll-Arie “Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben“ ist eines der 17 Stücke von 64 im ganzen Oratorium, zu denen auch der genannte Eingangschor "Tönet , ihr Pauken ..." gehört, das man Parodie nennt, d. h. hier hat Bach wiederum geschickt einem neuen Text die Melodie einer älteren Komposition beigelegt, unterlegt (gr. pará - bei, neben; gr. Ăłde – Lied, Gesang:). Diese Vorgängerarie entstammte Bachs weltlicher Kantate "Hercules am Scheideweg zwischen Tugend und Laster" (BWV 213,9). Das "Bereite dich Zion", dessen "Musik dadurch nichts verliere, dass sie ursprünglich für einen anderen Text geschrieben sei" (Ph. Spitta) soll die Erwartung des Heilands wie ein Liebeslied stimmungsvoll ausdrücken. Sie wurde beschwingt von der Altistin Caroline Bauer gesungen, von Oboe und Continuo-Instrumenten abgerundet und stellte so zweifellos ein Trio-Glanzstück unter den klangvollen, die Evangelientexte betrachtenden Arien dar, die zudem mit fast fünf Minuten Dauer eine der längsten Arien hier ist.
Ein grandioses Beispiel für effektvolle Arien bot dann das fast ebenso lange, stolze “GroĂźer Herr und starker König“, vom Solo-Bassisten Lorenz Miehlich kraftvoll gesungen und von virtuoser Solotrompete überglänzt. Bei ihr könnte die kraftvoll rhythmisiert ausgeführte synkopische Versetzung von Bass- und Trompetenstimme gegenüber der Begleitung geradezu bildhaft das Bezwingende und Herrschaftliche ausgedrückt haben.
Hingewiesen sei zur Stelle auch auf die von Bach im Oratorium vielfach verwendeten evangelischen Kirchenliedmelodien (zu und von Paul Gerhardt, Martin Luther), die Bach - der Einbeziehung der Gemeinde wegen - im Oratorium singen lieĂź, und zwar "in schlicht vierstimmigem, leicht polyphon gelockertem, überwiegend akkordischem Chorsatz und colla parte (notenparallel) geführten Instrumenten" (A. Dürr), nicht ohne orchestrale Einschübe. Sie wirkten wie wahre klangliche Ruhepunkte, wurden von den Choristen auch hier gut und gern gesungen. Auch dürften sie bei der zuhörenden Gemeinde Vertrautheit zum Werk geschaffen haben. Unter diesen Liedmelodien war auch der Adventschoral (1. Kantate) "Wie soll ich dich empfangen und wie begeg´n ich dir", der nach dem Passionslied von Paul Gerhardt "0 Haupt voll Blut und Wunden" in bangem a-Moll aus der Matthäuspassion (1729) erklang, einer Melodie, die ihrerseits auf einem Liebeslied von Hans Leo HaĂźler (um 1600) "Mein g´müth ist mir verwirret, das macht ein jungfrau zart" beruhte. Verbanden die Zuhörer von 1734 Passionsgedanken damit und auch mit dem Schlusschor "Nun seid ihr wohl gerochen (gerächt)" der sechsten Kantate? Ein unbefangenes Hören und Singen ist seit dem weiteren Bekanntwerden der Matlhäus-Passion wohl kaum möglich, obwohl es beqründete Ablehnung einer auf die Passion Jesu bezüglichen Anspielung Bachs gibt (A. Dürr, Kantaten Bachs 1, 1985, S. 134). Der Adventschoral wirkte also in langsamem Viervierteltakt und seinem Moll-Charakter auch hier doppelbödig, als sei die Freude über Jesu Menschwerdung schon von der Trauer um seinen Opfertod umschattet, als gebe es hier eine" Brücke von Weihnacht zur Passion" (M Walter). Ob das Bachs Absicht war?
Die zweite Kantate "Verkündigung von Jesu Geburt an die Hirten" wird als einzige der Kantaten von reinem instrumentalem Stück, einer G-Dur-Sinfonia (mit Bläsern, Streichern), eingeleitet. Nach Albert Schweitzers Bach-Buch (1908, Ausg.1942, S. 677-79) erlebe in dieser Kantate (Verkündigung des Engels an die Hirten) in der Eröffnungsmusik der Zuhörer "eine gewisse Enttäuschung". Statt eines zu erwartenden. sanften Pastorales. das doch den "weihevollen Eindruck des stemenbesäten Himmels" erwecken müsse, das er nach der Hirtenerzählung doch erwarten sollte, höre er "etwas Unruhiges." Mit diesem "äuĂźerst belebten Stück" könne ein Dirigent nur schwer "den Eindruck einer friedvollen Ruhe in der Natur" hervorbringen, wie es etwa in der Pifa, Händels Hirtenweihnachtsmusik aus dem "Messias", (oder in dem Pastorale aus Corellis Concerto grosso Op. 6 VIII Per la Notte di Natale oder dem von Manfredini Op. 3, 12) geschehe. Es sei also durchaus möglich, dass Bach diesen Eindruck gar nicht habe hervorbringen wollen. Schweitzer deutete daher die Sinfonia eher als einen Prolog, in dem in einer Art von musikalischer Szene Engel- und Hirtenchor in zwei einander gegenüber stehenden Themen miteinander abwechselnd innig, aber herzhaft und nicht schleppend musizierten, in dem der schwebend schwingende Siciliano-Rhythmus (12/8) den verzückten Engeln, die Schalmeienklänge der Bläser aber den gläubigen Hirten zukämen. Bei aller Vorsicht vor programmatischer Auslegung wird man also die Sinfonia doch "als gemeinsames Musizieren der Engel (Streicher, Flöten) mit Hirten (Oboen) Interpretieren dürfen" (A. Dürr, M. Walter). So bleibt das Tempo des Satzes umstritten. Die Fauß´sche Interpretation wirkte beschwingt. Sie neigte offenkundig der Schweitzer´schen Auffassung zu, auch wenn sie nur Ahnung Bach´scher Absicht bleibt.
In der Tenorarie "Frohe Hirten eilt, ach eilet" mit Sebastian Hübner, der auch den Evangelisten eindrucksvoll sang, konnte man bei den reichlichen Koloraturen, die wenig homophones Ausruhen erlaubten, eine Ahnung von der stimmlichen Anforderung an einen Bach-Sänger bekommen. Die Begleitung durch die Flöte und die Continuogruppe (Cello, Bass, Fagott ,Cembalo) wirkte leicht und mied jeden dicken Klang. Sie war hier - wie in der ganzen Aufführung - immer sicheres Fundament.
Einen langen Ruhepunkt - wiederum etwa fünf Minuten dauernd - bildet in der Kantate die Marienarie "Schlafe, mein Liebster, genieĂźe der Ruh´ ", eine Art Wiegengesang für das Jesuskind, der in der älteren Herkuleskantate Bachs Schlummerlied-Arie der “Voluptas-Wollust” für den jungen Hercules (BWV 213) gewesen und vom Komponisten gelungen umfunktioniert war. Die Altstimme von Caroline Bauer zeigte ein wohllautendes dunkles Timbre in den lang gehaltenen Anfangstakten und den schönsten Stellen der Arie um den Text "Wache nach diesem vor (für) aller Gedeihen".
Als Zentrum der Kantate gilt der monumentale dreiteilige Chor der Engel, der himmlischen Heerscharen "Ehre sei Gott in der Höhe” (über gleichartigen Bassfiguren sich entwickelnd - “Und Friede auf Erden” (mit dissonantischen Störungen, schmerzlich) - “Und den Menschen ein Wohlgefallen” - ( kanonisch mit jubelnden Koloraturen, freudig). In dem vielfältig strukturierten und chorisch betonten Gebilde konnte der Chor seine Geübtheit und Konzentration aufzeigen und FauĂź das gute Ergebnis seiner Einstudierung und sichere Führung mit gutem Gelingen. Vom kraftvoll marschartigen ersten Tell setzte sich so über verhaltenem Orgelpunkt der schmerzlich dissonant die Stimmen überschneidende Mittelteil ab. Die gekonnten Koloraturen des Chors im dritten Teil belegten erneut den hohen Stand der Gesangskunst, den die Kantorei erlangt hat.
In der dritten Kantate "Der Weg der Hirten nach Bethlehem" sind zunächst zwei Arien zu betrachten: das Duetto (Doreen Ziegler, Sopran und Lorenz Miehlich, Bass) "Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen" und die Altarie (Caroline Bauer) mit Solovioline (Erne Müller) "SchlieĂźe, mein Herze, dies selige Wunder". Das Duetto gelang als ein barockes graziöses Kabinettstück Das musikalische und sichere Spiel der Continuogruppe mit den beiden Oboen trug ganz ohrenfällig zu diesem schönen Klangerlebnis, als sei es ein Sänger-Bläser-Streicher-Oktett. Die Altarie, eine der wenigen Originalkompositionen für das Oratorium, die Bach besonders sorgfältig als Trio für die in den drei Kantaten besonders geforderte Altstimme, virtuos beanspruchte Violine und Orgel/Continuo-Gruppe in exakt mathematisch verzahnter Musik gearbeitet hatte, verfehlte ihre Wirkung bei den Liebhabern gerade dieser Arie nicht angesichts des beeindruckend gespielten virtuosen Violinparts und der schön geführten unisono-Stellen der Altstimme um den Text "SchlieĂźe ...fest in deinem Glauben ein".
Unter den Chören ein Wort zu dem Chor "Lasset uns nun gehen gen Bethlehem". Für die, welche den Kanon “al rovescio” (in Gegenbewegung), erwarteten, in dem die Chortenöre zuweilen nach oben, die Chorbässe gespiegelt nach unten singen, wäre es sicher interessant, das deutlich artikuliert und gesungen zu hören. Es bleibt aber doch wohl "in praxi" ein Wunsch, weil es "realiter" eben nur dem Blick in die Partitur möglich ist.
Der festliche Eingangschor zur Kantate III beginnt mit dem uns wohl erst heute unsäglich gewordenen Text "Herrscher Himmels, erhöre das Lallen", das sich auf "Lass dir die matten Gesänge gefallen" reimt und die Kantate auch "Da capo il coro" beschloss. Bach meinte aber damit bescheiden und eher demütig mit dem "Lallen" eigentlich nur ein aus göttlicher Warte heraus betrachtetes, noch kindlich unvollkommenes, stammelndes, eben nur menschliches, Gottes (noch) nicht würdiges Sprechen und Singen und nicht das in unserem heutigen Sinne herabsetzende Stammeln etwa eines Betrunkenen. Noch einmal war es aber auch wieder ein groĂźer Chorauftritt, ein Fest für die Trompeten und die bachversierte Heidelberger Kurpfalzphilharmonie. Die aufeinander folgenden Einsätze von Chortenor, -sopran und -alt gelangen genau und der Dirigent steuerte umsichtig die anspruchsvollen Koloraturen, die in durchsichtigem Satzgebilde gewissermaĂźen vor dem Hörer bloĂź liegen.
Viel Beifall und Standing Ovations, dazu Präsente feierten am Schluss herzlich und begeistert die ausführenden Gesangs- und Instrumentalsolisten, das Orchester und den Dirigenten. Besucher waren so zahlreich gekommen, dass kein Platz im Kirchenschiff unbesetzt geblieben sein dürfte. Bachs Zeitgenossen sollten die Kantaten einst als tönende Ergänzung zu den damaligen, nunmehr vergessenen Predigten empfinden. Rein musikalisch dürften sie diese nicht gerade kurzen Spitzenwerke Bachs indes auch schon bewundert haben, obschon der Rat der Stadt Leipzig seinerzeit Bach den Rat gegeben hatte, er solle "zu Beybehaltung guter Ordnung in den Kirchen die Music dergestalt einrichten, daĂź sie nicht zu lang währen, auch also beschaffen seyn möge, damit sie nicht opernhaftig herauskomme, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere", was Letzteres allerdings auch heute noch wünschenswert sein könnte.
24.12.24
|
.gif)
.gif)

.gif)
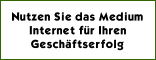
.gif)
.gif)

.gif)