In der Michaelskirche erklang die 1. Kantate aus Bachs Weihnachtsoratorium
(hr) (khm) Wer die originĂ€re Art einer Kantatenaufführung aus J. S. Bachs Weihnachtsoratorium einmal erleben wollte, konnte das - wie traditionell alljĂ€hrlich in Eberbach am zweiten Weihnachtsfeiertag - mit einer der sechs Kantaten im Gottesdienst am 26. Dezember in der Eberbacher Michaelskirche.
Ausführende waren die Evangelische Kantorei, die Kurpfalzphilharmonie Heidelberg, Caroline Bauer (Alt), Jun Won Lee (Tenor), Lorenz Miehlich (Bass), Arne Müller (Solo-Violine) und Bezirkskantor Andreas FauĂ (Leitung und Orgel).
Ăber die Auswahl aus dieser populĂ€rsten und melodiereichsten Bachschen Kirchenmusik für sechs Feiertag(sgottesdienst)e von Weihnachten bis zum Dreikönigsfest, also "die heilige Weyhnacht über" (Bach), wird wohl je nach Situation entschieden. Hier war aus der eigentlichen Weihnachtsgeschichte (Kantaten I-III, Geburt Jesu, seine Verkündigung an die Hirten, deren Gang nach Bethlehem), die beliebte erste Kantate gewĂ€hlt. Ihre jubelnde Einleitungsmusik dürfte die fröhliche und zuversichtliche Weihnachtsstimmung auch angemessen ausdrücken - nach dem Hören der besinnlich einstimmenden und eindrucksvollen KlĂ€nge zum Eingang aus dem meditativen "Pastorale" von Josef Rheinbergers "Sechs Stücke für Violine und Orgel" op. 150,2 in der Ausführung durch Arne Müller und Andreas FauĂ.
Dann wurde spür- und hörbar die frische Festlichkeit des dreiteiligen Eingangchores zur Kantate "Jauchzet! Frohlocket! Auf! Preiset die Tage!" vorgeführt. Ein Chor übrigens, der mit dem musikprogrammatischen "Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! Klingende Saiten, erfüllet die Luft!" schon als Glückwunchkantate Bachs (BWV 214,1 von 1733) zum Geburtstag der Frau des sĂ€chsischen Kurfürsten Friedrich August II. und zugleich polnischen Königs gedient hatte. Maria Josepha (1699-1757) war als Tochter Kaiser Josephs I. (1705-11) einmal eine der besten fürstlichen Heiratspartien gewesen als denkbare habsburgische Erbin. Das Erbe trat aber dann Josephs Bruder, der spĂ€tere Kaiser Karl VI. (und Vater Maria Theresias) an. Auf Maria Josephas Betreiben wurde auch die groĂe Dresdner katholische Hofkirche erbaut. Dieses ehrenhaften Kompositionsauftrags erwies sich Bach so würdig, dass die Wiederverwendung dieser Musik im Einleitungschor seiner ersten Weihnachtskantate erst richtig ihre bleibende QualitĂ€t zeigte. Im Orchestervorspiel gab es prunkvolle PaukenschlĂ€ge im Solo, helle Flöten- und Oboentriller sowie brillante Streicherskalen (TonleiterlĂ€ufe), dazu schmetternde Trompetenwucht, die vom Dirigenten FauĂ mit den anspruchsvollen und hörbar gut einstudierten Chorpartien verbunden wurden. Zwischen den wuchtigen Eckteilen des Chores stand ein Mittelteil mit selbstĂ€ndiger Thematik, der sich gut absetzte durch ruhigeren Verlauf und dynamisches Zurücknehmen. In dieser Kunst der dynamischen Differenzierung könnte ein begeistert singender Chor durchaus sich noch steigern.
Pfarrer Gero Albert stellte in seiner Festtagspredigt und guter Werkanalyse in der Kantatenmitte auch das Gliederungsschema von Bachkantaten plastisch vor, das sich hier gleich zweimal wiederholte, d. h. die Abschnitte âEvangelistenworte - freies Rezitativ - Arie - Choralâ entsprechen etwa dem "rechten Bibellesen" mit den Abschnitten âLesung - Betrachtung - Gebetâ, die bei Bach mit einem Amen der Gemeinde (Choral) abgeschlossen würden (Alfred Dürr).
In diesem ersten Teilabschnitt interessierte dann vornehmlich die stimmungsvoll von Caroline Bauer gesungene Altarie "Bereite dich Zion" mit kleiner besetzter Begleitung und führender Violin-Oboen- Mitwirkung. Die Arie handelt von der richtigen Erwartung des kommenden Heilands, wobei "die Musik an Schönhit dadurch nichts verliere, daĂ sie ursprünglich für einen anderen Text geschrieben sei" (Ph. Spitta), nĂ€mlich der weltlichen Bach-Kantate "Hercules am Scheideweg zwischen Tugend und Laster" (BWV 213, 9). Von evangelischen Kirchenliedern lieĂ Bach einige - wohl der Einbeziehung der Gemeinde wegen - in Kantaten singen, "in schlicht vierstimmigem, leicht polyphon gelockertem, überwiegend akkordischem Chorsatz und colla parte (notenparallel) geführten Instrumenten" (A. Dürr), nicht ohne orchestrale Einschübe. Die beiden ChorĂ€le dieser Kantate wirkten auch hier wie wahre klangliche Ruhepunkte, von den Choristen gut und ausdrucksvoll gesungen. Dabei war der Adventschoral "Wie soll ich dich empfangen", der nach der Melodie des Passionsliedes von Paul Gerhardt "O Haupt voll Blut und Wunden" (MatthĂ€uspassion von 1729) gesungen wird mit einer Melodie identisch, die ihrerseits auf dem Liebeslied von Hans Leo HaĂler (um 1600) "Mein GÂŽmüth ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart" beruhte. Sollten die Zuhörer von 1734 und heute Passionsgedanken schon in Jesu Geburtsmoment empfinden? Ein unbefangenes Hören ist seit dem weiten Bekanntsein der MatthĂ€us-Passion wohl nicht mehr möglich, obwohl es begründete Ablehnung einer auf die Passion Jesu bezüglichen Anspielung Bachs gibt (A. Dürr). Der Adventschoral könnte aber doch doppelbödig wirken, als sei die Freude über Jesu Menschwerdung schon von der Trauer um seinen Opfertod umschattet, als gebe es hier eine "Brücke Weihnacht zur Passion" (M. Walter).
Im zweiten Viererabschnitt-Teil der Kantate - nach Unterbrechung durch die Festtagspredigt und nach der kurzen Evangelistenlesung - hörte man den von Bassrezitativen kommentierend unterbrochenen, von Chorsopranen allein gesungenen âChoralâ auf den Luthertext "Er ist auf Erden kommen arm". Er gehört in seiner Anlage wohl zu den schönsten Eingebungen Bachs. Hier bildete zu dem hellen Stimmklang die sonore Stimme des Bassisten Lorenz Miehlich den kraftvollen Kontrast.
Die freudige, von Trompetenklang überglĂ€nzte Bassarie "GroĂer Herr, o starker König, liebster Heiland" mit spannungsgeladenen Synkopen und Dreiklangsthematik, ebenfalls vom Bassisten stolz und kraftvoll gesungen, ragte auch durch das virtuose Spiel der Trompete hervor mit dem Ergebnis eines grandiosen Arienbeispiels. Es gibt die Frage, wie sich der triumphale instrumentale Klang der Arie zum Text verhalte, der von Jesu Schlafen "in harten Krippen" spricht. Etwas von diesem Kontrast wird schon dadurch bedingt sein, dass auch diese Arienmelodie aus der genannten Glückwunschkantate (BWV 214,7) stammt und Bach wohl eine "musikalische Nachzeichnung des Textes" (A. Dürr) nicht für wichtig hielt.
War der erste Choral "Wie soll ich dich empfangen" noch schlicht vierstimmig mit colla parte geführten Instrumenten, so war der Schlusschoral auf die lutherische Weihnachtsmelodie "Vom Himmel her da komm ich her", die textlich ja auch Jesu Geburt feiert, reicher ausgestattet (mit Streichern, HolzblĂ€sern, Trompeten, Pauken) Dem Jesuskind wird herzliche Liebe beteuert, wĂ€hrend festliche TrompetenklĂ€nge die Himmelskönigin feiern. Es war ein auĂergewöhnliches Klangfest.
Dass viel Beifall die Ausführenden, SĂ€nger, Solisten und den Dirigenten herzlich und begeistert feierte, war wohl selbstverstĂ€ndlich. Zum Dank gab es noch den verkürzten Anfangschor, der die Erlösungsfreude so deutlich ausdrückte. Hatten Bachs Zeitgenossen die Kantaten einst gedacht als PredigtergĂ€nzung in Tönen zu den damaligen, nunmehr vergessenen Kanzelpredigten, so haben diese Kantaten sich weit wirkmĂ€chtiger erwiesen als jene, denn âsie sprechen direkt zu den Sinnenâ und âerreichen bis heute immer noch die Ohren allerâ (Eleonore. Büning, FAZ 15.12.2007, S. 38).
Nicht unerwĂ€hnt sollte bleiben, dass im Rahmen der gottesdienstlichen Schlussliturgie wegen ihrer Verdienste für die Kirchengemeinde als langjĂ€hrige Beraterin, Lektorin. KirchengemeinderĂ€tin und Bezirkssynodenvorsitzende Dr. Barbara Scheuble von Pfarrer Gero Albert in einer gereimten Rede dankend geehrt und mit Bedauern verabschiedet wurde.
27.12.22
|
.gif)
.gif)
.gif)
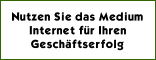

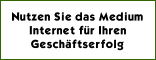
.gif)

.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
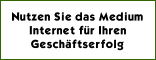

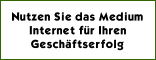
.gif)

.gif)