Applaus mit Standing Ovations zum Dank und zur Anerkennung
(bro) (khm) Am vergangenen Samstag wurde in der evangelischen Michaelskirche in Eberbach Johannes Brahms »Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift« aufgeführt unter Leitung von Thomas Kalb, der Ă€lteren Eberbachern als GMDirektor des Heidelberger Philharmonischen Orchesters noch erinnerlich sein dürfte.
Es war hier zu hören in der Fassung für Kammerensemble (Chor und Orchester), erstellt von Joachim Linckelmann (* 1964), Flötisten und geschĂ€tzten Musikarrangeur (z. B. von Brahms Requiem, Verdis Messa da Requiem usw.). Die Bearbeitung war für solistischen Sopran und Bariton, Chor (Sopran, Alt, Tenor, Bass), Orchester (Piccolo, Oboe, Flöte, Klarinette, Fagott, Horn, Pauken) und Streicher (Violinen, Violen, Celli und Kontrabass), d. h. praktisch für Streich- und HolzblĂ€serquintett, also ohne BlechblĂ€ser, weshalb an besonders markanten Stellen die Oboe als Holzblasinstrument mit dem klarsten Ton die Rolle der Trompete-Posaune übernimmt. Es musizierte also kein ganz groĂes Orchester. Bei einer Eberbacher Aufführung 1987 waren es 57 Instrumente gewesen, sodass sich damals wohl ein Ungleichgewicht zum Chor eingestellt haben durfte. Brahms hatte für das Werk 200 SĂ€nger vorgesehen, die man aber erst einmal finden muss. So machte also ein eher kammermusikalisches Format von Chor und Orchester hier durchaus Sinn.
Ăber den Wert von Bearbeitungen gröĂerer Chor- und Orchesterwerke hat nun Alban Berg bereits beherzigenswerte Gedanken gehabt, und zwar anlĂ€sslich eines legendĂ€ren Wiener âWalzer Abendsâ 1921 (27. Mai), bei dem vier Walzer von Johann Strauss (Sohn), arrangiert von Alban Berg, Arnold Schönberg und Anton von Webern, erklangen. Es war eine Situation, wo deren Verein nicht über Mittel verfügte, ein groĂes Orchester zu engagieren, also gröĂere Chorsachen und auch Orchesterwerke nur in guten und gut studierten Arrangements reproduziert werden mussten. Berg fĂ€hrt fort: âAber einmal vor eine solche neue Aufgabe gestellt, wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Es ist nĂ€mlich auf diese Weise möglich, Orchesterwerke - aller Klangwirkungen, die nur das Orchester auslöst, und aller sinnlichen Hilfsmittel entkleidet - zu hören und beurteilen zu können. Damit wird der allgemein übliche Vorwurf entkrĂ€ftet, dass diese Musik ihre Wirkung lediglich ihrer mehr oder minder reichen und effektvollen Instrumentation verdanke und nicht auch alle diese Eigenschaften besĂ€Ăe, die bisher für eine gute Musik charakteristisch waren: Melodien, Harmoniereichtum, Polyphonie, Formvollendung, Architektur etc.â Diese Ideen waren schon einmal 2020 in Eberbach wichtig gewesen, als die Requiem-Bearbeitung von Heinrich Poos (mit zwei Klavieren und Pauken) geplant wurde.
Kommen wir zum kirchenmusikalischen Ereignis am vergangenen Samstag. Es konnte sich wohl hier hören lassen, was versierte Solisten: Judith Wiesebrock (Sopran) und Jan-Ole Lingsch (Bariton), ein mit Begeisterung singender und musizierender jugendlicher Chor samt Orchester und ein engagierter Dirigent Thomas Kalb zusammen mit einstudierendem Chorleiter Mathias Rickert hier aufzuführen vermochten. Für den mit erfahrener Hand das Ganze leitenden Dirigenten Thomas Kalb wird man Franz Liszt zitieren mit dem Lob, dass Dirigenten keine Ruderknechte sind, sondern Steuerleute.
Der einleitende Requiemsteil handelt von der âzweiten Seligpreisungâ (Bergpredigt, Matth. 5,4): âSelig sind, die da Leid tragenâ, das vornehmliche Thema und Anliegen des Requiems, Leidenden Trost zu spenden und Todesangst zu überwinden, wobei die folgenden Teile weitere Formen von Tröstung aufzeigen sollten. Gerade im Des-Dur-Mittelteil bei den Worten âDie mit TrĂ€nen sĂ€enâ (Ps 126, 5â6), in dem Brahms barocke Ausdrucksmittel wie Halbtonfolgen und Tonsprünge über ungewöhnliche Intervalle anwendete, gelang es, Leidensstimmung zu erzeugen, dann aber auch die Melodik bei den Worten âwerden mit Freuden erntenâ sich aufhellen zu lassen.
Im zweiten Teil, einem gewichtigen Trauermarsch oder Totentanz, der sich mit einem düsteren Choral verbindet, hatten die Pauken einen besonderen Auftritt. Ihr stetiges Pochen, welches das Unerbittliche des Todes eindringlich malte und wie eine Illustration zu Horazens den p-Buchstaben alliterierenden Vers "Pallida mors aequo pulsat pede - klopft doch der Tod, der bleiche, an mit gleichem FuĂ" (c. 1,4,13) wirken konnte. Es wurde zum faszinierenden tonalen Sinnbild des allgewaltigen Todes und der VergĂ€nglichkeit, wie es das Jesaja-Zitat im Petrusbrief (1,24) âDenn alles Fleisch ist wie Grasâ vermeldet. Alle Nuancen des Paukenschlags waren so zu hören: zum einen das ungerührte Anpochen des Todes, das bis zum âzerschmetternden Fortissimoâ gehen konnte. Der Paukenschlag konnte aber auch bei inhaltlich ganz anders gestimmter Stelle passend sein, wenn er etwa zum Choreinsatz âAber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit" erklang, gleichsam die Glaubensfestigkeit ohrenfĂ€llig machend.
Erster und zweiter Teil des Requiems zeigen die allgemein die Menschen betreffenden Stimmungen. Der dritte Teil geht über zum einzelnen Menschen und zu persönlicher Todesangst. Dies zu verkörpern fiel dem Chor und dem Bariton zu. Mit kraftvoller Stimme, wie sie die Art des noch nicht Resignierenden wohl auch ist, sang dieser vom Menschen (Ps. 39,5-8), der sich mit seiner Endlichkeit nicht abfinden will, aber muss, ein Gedanke, der im musikalischen Kontext auch Ausdruck fand: "Herr lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben wird." Die hier folgende Fuge über einem 36 Takte hinweg grundierenden D-Ton und unermüdlichem Paukenrhythmus stellte wie bei jeder Aufführung eine anspruchsvolle Aufgabe dar und war so als groĂe Fuge der Glaubenszuversicht gestaltet. Am Rande sei noch erwĂ€hnt, dass dieser gefürchtete Fugenteil bei einer der Wiener Voraufführung 1867 auf heftige Ablehnung stieĂ. Die Einen sprachen von erschreckender akustischen Wirkung hervorgerufen durch die BrutalitĂ€t des Paukers. Ein anderer hatte die Empfindung, die man beim Eisenbahn-Fahren durch ein sehr langes Tunnel habe.
Der vierte Teil mit "Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth" (Ps. 84, 2 - 5) konnte nach den Todesgedanken in den ersten SĂ€tzen pastoral-idyllische Entspannung vermitteln, zumal nach der vorausgegangenen Fuge. Wohlklang, an dem die Flöten (Einleitungstakte), der einfühlsame Chor, schwelgende Violinen gleichermaĂen Anteil hatten, wirkten dahin, gleichnishaft ein tönendes Abbild seligen Lebens erstehen zu lassen.
Der fünfte Teil mit dem Sopransolo "Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wieder sehen" (Ev. Joh.16, 22) mit seiner abschlieĂenden Wendung "Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet" lieĂ vermuten, dass Brahms - damals 35jĂ€hrig - mit ihm an den Tod seiner Mutter (gest. 1865) erinnern wollte, weshalb der Satz auch "Muttertrost" genannt ist. So hatte die Sopranistin, die nur hier im Requiem auftritt, einen Brahms sicher besonders bedeutsamen Part zu singen. Mit fester, klarer Stimme wusste sie das Tröstliche selbstsicher und verstĂ€ndlich vorzutragen, ohne ins Gefühlige abzugleiten. ErwĂ€hnt seien hier auch die schönen Soli von BlĂ€sern und Streicher, Flöte, Oboe und Cello im Satz.
Brahms Requiem ist keine liturgisch lateinische Totenmesse (missa pro defunctis), die wie alle Messen eine fünfteilige, aber erweiterbare Textgrundlage gehabt hĂ€tte: Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus - Benedictus. Brahms Requiem ist eine auf protestantischer Tradition fuĂende, deutschsprachige Totenmusik und sollte keine für einen Toten sein, sondern eine Trauer- und Trostmusik allgemein für alle, "die da Leid tragen" (M. MĂ€ckelmann, Beiheft S.5, CD Wiener Philharmoniker, Dt. Grammophon 1988). Doch das Requiem kommt der traditionellen Totenmesse noch am ehesten hier nahe im ausgedehnten sechsten Teil: "Denn wir haben hier keine bleibende Statt" (Hebr, 13,14)". Der "Dies irae - Tag des Zorn, des göttlichen Gerichts" ist allerdings bei Brahms eher gedĂ€mpfter. Er verzichtet auf ein Dies-irae-Schreckenstableau. Vorrang haben für ihn zweifellos die paulinischen Worte vom Sieg über den Tod (1. Korinther 15; 51-55), wo Brahms allerdings, eine allgemeine Vernunftreligion vertretend, den 57. Vers weglĂ€sst, der besagt, dass der Sieg über den Tod gegeben ist durch Jesus Christus, der im Werk übrigens unerwĂ€hnt bleibt, was des Requiems kirchliche Aufführung auch schon be- bzw. verhindert hat. Bei der Bremer Uraufführung wurde damals daher die berühmte Arie eingefügt: "I know that my Redeemer liveth - Ich weiĂ dass mein Erlöser lebt" aus HĂ€ndels Messias.
Hier aber feierten wohl OboenklĂ€nge (für die der originĂ€ren Posaunen) den Sieg über den Tod und riefen nicht zum Gericht. ErwĂ€hnen sollte man die stimmliche Kraft des Baritons zur Stelle, die klangvoll und verstĂ€ndlich über die Orchesterbegleitung sich erhob. Zum Abschluss führte eine groĂe Doppelfuge (142 Takte): "Herr, Du bis würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft" (Offenbarung Joh. 4,11). Mit diesem "Dankgesang" stellte sich dem Chor die wohl gröĂte Anforderung im Konzert, die Brahms vielleicht im Sinne einer Bach-Ehrung und des Satzes "fuga coronat opus" den Ausführenden gestellt hat.
Wenn schon jeder Satz des Requiems die Wandlung von Todesschrecken in Tröstung andeutete, so war der ganze siebente Teil der tröstliche Abschluss, ausgedrückt mit einer weiteren Seligpreisung, die sich auf den ersten Satz des Requiems zur Tröstung der Hinterbliebenen beziehen konnte. Diese Seligpreisung lautete: "Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit." (Offenbarung Joh. 14,13), wobei das "von nun an" schon gedeutet worden ist, als habe Brahms hier an Jesus gedacht, er dies aber nicht gemeint haben will. Diese Seligpreisung lieĂ das erreichte Ziel erkennen, das der Name des Brahmsschen Werkes bereits angezeigt hatte: "REQUIEM (aeternam dona eis Domine) - RUHE (ewige gib ihnen, Herr). Mit dem Ausdruck, dass die Sterbenden nun "ruhen von ihrer Arbeit" hat Brahms geradezu Gedanken von Max Weber vorweggenommen, der ein Sterben nicht in Lebensmüdigkeit, sondern in Lebenssattheit wünschte und pries.
Mit dem Ende des Konzerts brach dann begeisterter, lang dauernder Applaus mit Standing Ovations los - spontan zum Dank und zur Anerkennung für die überzeugende Leistung der jungen Ausführenden, ihres Chorleiters und ihres Dirigenten.
10.02.25
|
.gif)
.gif)
.gif)
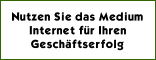

.gif)
.gif)

.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
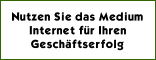

.gif)
.gif)

.gif)