Violine und Klavier erklangen im Evangelischen Gemeindehaus
(hr) (khm) Am Freitag, 26. September, luden die Kunstfreunde Eberbach zum 4. Kammerkonzert ein. Es spielte das Violin-Klavier-Duo Vladimir Rivkin und Uwe Balser im Evangelischen Gemeindehaus. Damit wurde ein Konzert nachgeholt, das im Mai 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war.
Zu h√∂ren war zun√§chst die viers√§tzige ‚ÄúSonate‚ÄĚ in A-Dur für Violine und Klavier op. post. 162 D 574 (1817) von Franz Schubert (1797 - 1828). Das "Grand Duo pour le Piano compos√© par Fran√ßois Schubert" genannte Werk entstand ein Jahr nach seinen drei "Sonat(in)en" op.137,1-3. Die verniedlichende Bezeichnung "Sonatinen" sollte wohl auf leistbare spieltechnische Anforderungen hinweisen.
Die A-Dur-Sonate indes forderte hier wie im ganzen Programm deutlich ausgesprochen virtuose Spielfertigkeit, und das bei so vielen zu beachtenden musikalischen Feinheiten. Schlie√ülich hatte man 16 gewichtige Einzels√§tze vorzutragen, wenn man noch die zwei Zugaben einrechnete, was praktisch fünf dreis√§tzigen Sonaten entspr√§che.
Der erste Satz (Allegro moderato) stand in Sonatensatzform, bei der die Einleitungstakte, die zwei Themenvorstellungen, die Violinkantilenen und die energische Thematik, deutlich und klangvoll herausgearbeitet waren.
Das Scherzo presto erinnerte mit "stürmischer, aufw√§rts gerichteter Akkordbrechung" zu Anfang und mit munterem Verlauf unüberh√∂rbar an Beethoven. Das Trio dagegen lie√üen die Musiker eher gemütlich im Dreivierteltakt vom stürmischen Scherzo sich abheben.
Das langsame dreiteilige Andantino zeigte zuerst ein melodiöses Thema. Es kehrte zweimal variiert wieder und wurde mehrmals von wuchtigen Forteschlägen unterbrochen. Der Mittelteil enthielt ein neues sangliches Thema mit langen, kunstfertigen Überleitungen hin zum veränderten Schlussteil.
Der finale Allegro vivace, wieder in Sonatensatzform, erklang in seinem ungestümen Dreiertakt fast wie ein zweites Scherzo, geschickt gemildert durch ein lyrisches und ein t√§nzerisches Seitenthema.
Weiter ging es mit einer Sonate von Robert Schumann (1810-1856) aus dem Jahr 1851. Die Zeit von 1828-1839 widmete Schumann fast nur der Klaviermusikkomposition. Es folgte 1840 eine erste Periode der Liedkomposition. Innerhalb kürzester Zeit komponierte er 1842 seine bedeutendsten Kammermusiken: drei Streichquartette op.41, das Klavierquintett op. 44 und Klavierquartett op. 47. Auch seine beiden bekannten Violin-Klavier-Sonaten op.105 (a-moll. ca. 18 Min.) und op.121 (d-moll, ca. 35 Min.) entstanden schubweise im Herbst 1851, und zwar auf Anregung des Geigers Ferdinand David.
Schumanns Sonate von 1851 ist mit 18 bis 19 Minuten Dauer ein recht kleines Werk zu drei S√§tzen, wobei die Musiker mit zwei überwiegend aufgewühlten und ungestümen Au√üens√§tzen einen ruhigeren und anmutigeren Mittelsatz zu umspielen hatten. Gesch√§tzt an der Sonate wurde immer der gleichwertige Dialog, in dem Violine und Klavier hier stets miteinander stehen.
Der erste Satz "Mit leidenschaftlichem Ausdruck" (a-moll, 6/8 Takt) zeigte mit in seiner bewegten Melodik, über ruhelos wogendem Sechzehntelspiel des Pianisten und mit h√§ufigen Synkopen und dem rhythmischen Schwanken zwischen 6/8- und 3/4-Takt eindrucksvoll die leidenschaftliche Stimmung dieses atemlos aufwühlenden Satzes.
Im Mittelsatz "Allegretto" (F-Dur, 2/4 Takt), entfalteten die Musiker apart die zweiteilige Struktur von schlichter Liedhaftigkeit eines langsamen Satzes und die von kaprizi√∂s scherzhafter Rhythmik eines Tanzsatzes Dieser zweiteilige Abschnitt wurde wiederholt und Einschübe dazwischen geschoben wie bei einer Rondoform.
Im Schlusssatz "Lebhaft" (a-moll, 2/4 Takt) führten Piano und Violine motorisch eine Sechzehntel-Hauptthematik vor, die wie in einem Stück von Bach toccatenhaft (wie eine Toccata - Tastenstück), ungestüm vorw√§rts stürmte und kaum gebremst war durch einen elegischen Einschub.
Drittes Werk des Abends war Johannes Brahms¬ī (1833-1897) Sonate Nr. 1 G-Dur, op. 78 (Wvz. 390, 1878/9, 28 Min. Dauer) für Violine und Klavier, genannt ‚ÄúRegenlied-Sonate‚ÄĚ. Sie ist die erste von drei Violinsonaten, deren andere op. 100 (3 S√§tze) und op.108 (4 S√§tze) in den Jahren 1886-88 entstanden sind. Unter seinen 24 Kammermusikwerken sind sie Teil der 16, bei denen er das Klavier verwendete, und geh√∂ren zu seinen h√§ufig gespielten Werken. Sie entstammen alle seiner "reifsten Meisterzeit".
In dieser Zeit zeigte Brahms viel Anteilnahme an den famili√§ren Sorgen der befreundeten Clara Schumann, die sich h√§uften, als Claras Sohn Felix, Brahms¬ī Patenkind, 1872 an Tuberkulose erkrankte und 24-j√§hrig starb. Schmerz und Trauer sollten wohl den liedhaften Mittelsatz Adagio pr√§gen mit einer trauermarschartigen Bewegung und düsterem Mollumschlag. Nicht zu überh√∂ren, schon im ersten Satz ist der Anklang eines Brahmsliedes mit punktiertem Rhythmus zu zwei Dichtungen von Klaus Johann Groth (1819-99). Daraus ein Zitat aus dem 2.Teil: "Regentropfen aus den B√§umen fallen in das grüne Gras. Tr√§nen meiner trüben Augen machen mir die Wange nass ..."
Anders als die beiden anderen Sonaten, die deutlich für den Konzertsaal und für Virtuosen geschrieben waren, gibt sich diese erste Sonate betont liedhaft und gepr√§gt vom Melodischen, was der Violine als Melodietr√§ger eine hervortretende Rolle verleiht über einem gleichwohl gewichtigen Klaviersatz.
Der lyrisch gestimmte erste Satz Vivace ma non troppo zeigte die sich steigernde melodische Entwicklung und eine deutliche Nähe zu einer vokalischen Gattung, dem Sololied, woraus sich ein wohlklingendes Duettieren der beiden Instrumente ergab.
Im langsamen Satz Adagio / pi√Ļ andante (Es-Dur, 2/4 Takt) intonierte das Klavier allein zun√§chst eine feierliche Einleitung, der sich die Violine wie eine Singstimme anschloss. Im Mittelteil ‚Äúpi√Ļ andante‚ÄĚ lie√ü man betont das punktierte Motiv erklingen, das dem Regenlied entstammte und das so den Eindruck eines Trauermarsches erregen konnte, und auch auf den frühen Tod des jungen Felix Schumann damals sich beziehen sollte.
Das finale Allegro molto moderato (g-moll > G-Dur, 4/4 Takt) ist ein Rondo, das sich einer fast unaufh√∂rlichen 16tel-Bewegung bediente. Sein wiederkehrender Refrain (Ritornell) lehnt sich nahezu gleich an das Brahmssche "Regenlied"-Thema (op. 59,3 und 4) an, das sich über die drei S√§tze hinweg immer deutlicher h√∂ren l√§sst.
Mit der siebten Klavier-Violin-Sonate (G-Dur op. 30/2, 1802) von Ludwig van Beethoven (1770-1827) endete das Konzertprogramm. Beethoven hinterlie√ü in seinem gewaltigen Kammermusikwerk auch zehn Klavier-Violin-Sonaten, geschaffen zwischen 1798 und 1812. Es handelt sich um: Op. 12/1-3 von ca. 1798, Op. 23 und 24 (‚ÄúFrühlingssonate‚ÄĚ) von 1801-02, Op. 30/1-3 von 1802, Op. 47 (‚ÄúKreutzer-Sonate‚ÄĚ) von 1803 und Op. 96 von 1812. Sie sind alle nach 1797/98 und vor 1812 entstanden, d. h. innerhalb von 15 Jahren. Genau genommen komponierte er in den sechs Jahren zwischen 1797/98 und 1803, dem Entstehungsjahr der Kreutzer-Sonate, davon neun. Die letzte und zehnte entstand nach zehnj√§hriger Pause 1812.
Die Sonate Op. 30,2 entstand in seiner mittleren Schaffensperiode, die als die "konzertante" bezeichnet wird, und erhielt - was Beethoven liebte - auch einen Beinamen: "Hahnenschrei". Gewidmet war das Opus 30 dem Zaren Alexander I. und seiner badischen Frau Elisabeth in Wien 1814-15 beim Wiener Kongress, der die napoleonischen Kriege beendete. Die Sonate ist nicht wie üblich in konzertartiger Dreis√§tzigkeit geschrieben sondern sinfonieartig viers√§tzig (zu ca. 28 Minuten Dauer) wie auch die hier vorausgehende Sonate von Schubert. W√§hrend noch bei Beethoven als Pianist im Duo das Klavier der Violine gegenüber oft noch dominierte, zeigte die Sonate hier schon eher Gleichberechtigung beider Instrumente.
Die Sonate c-moll op. 30/2 (25 Min. Dauer) gilt als bedeutendste von Opus 30, hervorragend durch "Ernst und dramatische Kraft" wie sie das Hauptthema des Kopfsatzes Allegro con brio (in c-moll) erwarten lie√ü, trotz seines eher lyrisch gestimmten Seitenthemas: So entwickelte der Satz sich leidenschaftlich mit h√§ufigen, pl√∂tzlich aufeinander treffenden dynamischen Differenzierungen und überraschenden Effekten.
Der zweite Satz Adagio cantabile in As-Dur zeigte "gesangerfüllt", wie die Satzbezeichnung es ankündigt, wohlklingende, innige Melodik, die allerdings zweimal von heftig dazwischenfahrenden L√§ufen unterbrochen wurde, wie wenn Beethoven an die "ernste Grundhaltung und dramatische Gespanntheit" in der Sonate erinnern wollte, auch wenn die zuerst im Klavier vorzutragende Melodie in ihrer Klanglichkeit auch an die heiterere Klassik erinnern mochte.
Das folgende Scherzo Allegro mit Trio (in hellem C-Dur) wirkte als ein freudiger Ruf. Das Trio war gegen die Erwartung nicht als Gegensatz zu seinem Scherzo gestaltet, sondern eher kanonartig als eine Variation des Scherzos. Im finalen rondoartigen Allegro Presto stieg das Thema gleichsam steil und grollend aus der Tiefe empor. Dramatische Spannung kennzeichnete auch diesen Satz mit zwei vielfach variierten Themen, bis der Satz in einer stürmischen Presto-Stretta (Beschleunigung) ausklang.
Zum Schluss erklatschte sich ein begeistertes Publikum von den unermüdlichen Musikern noch zwei Zugaben. Es waren "Melodie für Violine und Klavier" von Peter Tschaikowsky und "Kleiner Wiener Marsch" von Fritz Kreisler.
01.10.25
|
.gif)
.gif)
.gif)
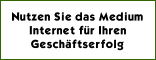

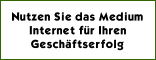
.gif)

.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
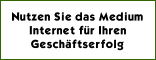

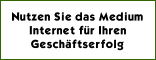
.gif)

.gif)